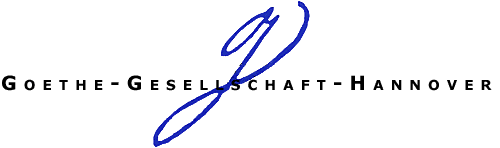
Vorträge
08.10.2025 Meier: Leben, Werk, Bedeutung Boccaccios17.09.2025 Clark: Die Gaerten des Biedermeier
10.09.2025 Seng: Shakespeares Einfluss auf Goethe
03.09.2025 ENTFALL: Goethe im Urteil Nietzsches
28.08.2025 Trauschke: Mein Goethe
26.06.2025 Schutjer: Faust und die hebr. Bibel
04.06.2025 Wilson: Goethe, Juden und Konvertiten
07.05.2025 100 Jahre Goethe-Gesellschaft Hannover
26.03.2025 Kuschel: Thomas Mann und das Judentum
12.03.2025 Clark: Die Gaerten des Biedermeier
12.03.2025 Mitgliederversammlung 2025
15.01.2025 Scheck: Goethe in Italien
20.11.2024 Schroeder: Werther auf der Buehne
13.11.2024 Siebert: Weihnachten bei Kestners
11.11.2024 Testvortrag
23.10.2024 Saltzwedel: Werther in seiner Epoche
16.10.2024 Gespraechskonzert: Werther und die Musik
12.09.2024 Kosenina: Fallgeschichten im Werther
28.08.2024 Weil: Mein Goethe
26.06.2024 Gaskil: Werther in engl. Uebersetzung
12.06.2024 Osten: Die Krankheit zum Tode
29.05.2024 Selbstmord von der Seele schreiben
15.05.2024 Alt: Die Traenen des jungen Werthers
06.05.2024 Safranski: Franz Kafka
24.04.2024 Goerner: Leiden an Werther
18.04.2024 Lund: Werther und die Salons (III)
10.04.2024 Stach: Franz Kafka und der Prozess
19.03.2024 Wehner: Werther - ein Lektuerekurs (II)
13.03.2024 Lund: Werther und die Salons (II)
06.03.2024 Piepenbring-Thomas: Der Kestnernachlass
06.03.2024 Mitgliederversammlung 2024
21.02.2024 Lund: Werther und die Salons (I)
20.02.2024 Wehner: Werther - ein Lektuerekurs (I)
31.01.2024 Meier: Werther-Rezeption in Italien
17.01.2024 Foerster: Kant im Lichte Goethes
21.11.2023 Meuer: Wieland an Knebel
20.11.2023 Gerhardt: Kant in globaler Perspektive
16.11.2023 Schupp: Food of the Gods
08.11.2023 Reemtsma: Christoph Martin Wieland
04.10.2023 Kuschel: Goethe und der Islam
30.08.2023 Oswald: August von Goethe
28.08.2023 Brandt: Mein Goethe
07.06.2023 Hörisch: Goethes bestes Buch
10.05.2023 MĂŒller-Fabbri: Ottilie von Goethe
12.04.2023 Niedermeyer: Goethes Wörterbuch
08.03.2023 Wehrhahn: Der Wehrhahn Verlag
08.03.2023 Mitgliederversammlung 2023
15.02.2023 Bredekamp: Michelangelo und Florenz
08.02.2023 Seng: Catharina Elisabeth Goethe
11.01.2023 Hölscher: Das Grab des Tauchers
01.01.2023 ENTFALL: Hoeppner: Goethes Bibliothek
01.01.2023 *AUSFALL* - Adler: Erfinder der Moderne
29.11.2022 Meuer: "AuserwÀhlte Frauen"
12.10.2022 Maatsch: Novalis und die FrĂŒhromantik
28.09.2022 Naumann: Schelling und die Klimakrise
21.09.2022 Jaeger: Faust und die Utopie der Moderne
28.08.2022 Becker: Mein Goethe
25.08.2022 Matuschek: Romantische Schönheit
24.06.2022 Science Slam: Wir können auch anders
02.06.2022 Kehnel: Geschichte der Nachhaltigkeit
11.05.2022 HĂŒcking: Ich schwimme in Rosen
06.04.2022 Anders: Intendantin des Schauspielhauses
06.04.2022 Mitgliederversammlung 2022
28.03.2022 Wanning: Schlegel
25.03.2022 Appel/KoĆĄenina: Demokratie
09.03.2022 Kaube: Wozu Hegel?
23.02.2022 Hörisch: HÀnde
17.11.2021 Seemann: Weihnachten in Weimar
17.11.2021 Mitgliederversammlung 2021
27.10.2021 Osten: âDie Welt, ein âgroĂes Hospitalââ
17.09.2021 Meier/Hufschmidt/Culo: Dante Al
08.09.2021 Schuler: Goethe und Napoleon
28.08.2021 Bahr: Mein Goethe
25.08.2021 Görner/Koƥenina: Imagination
08.07.2021 Sloterdijk: Theopoesie
05.07.2021 Safranski: Komm! ins Offene, Freund!
28.06.2021 Lewitscharoff: Abenteuernde Geistigkeit
16.06.2021 Stierle: Dantes âDivina Commediaâ
01.01.2021 *Ausfall* Kienzle:Schumanns Faust-Szenen
06.10.2020 Detering: Metamorphosen im Meer
08.09.2020 Kollwitz: Wahrheit der fĂŒnf Sinne
08.09.2020 Mitgliederversammlung 2020
28.08.2020 Guse: Mein Goethe
04.02.2020 GĂŒlke: âGenie in einem groĂen Schattenâ
14.01.2020 BĂŒning: âAbends bei Beethoven.â
01.01.2020 *AUSFALL* Clark: âGarten an der Leineâ
01.01.2020 *AUSFALL* Stemmler: Goethe & Frieder
03.12.2019 Meuer: Gedicht aus der Sammlung Culemann
06.11.2019 Dieterle: Fontanes Werke neu gelesen
22.10.2019 Wilson: Der Faustische Pakt
10.09.2019 Meuer: âDas Abendmahl des Herrnâ
27.08.2019 Mein Goethe
11.06.2019 SchĂŒtterle: Trinken und schreiben
22.05.2019 Grawe: Fontane und der populÀre Roman
02.04.2019 Schelle-Wolff: Stadtbibliothek im Wandel
02.04.2019 Mitgliederversammlung 2019
12.03.2019 Spiegel: Goethes letzte Worte
12.02.2019 Bohnenkamp-Renken: Neue "Faust"
15.01.2019 Holl: Goethe und Alexander von Humboldt
04.12.2018 Meuer: Goethes Zahme Xenien
06.11.2018 Seng: Monsieur Göthé
16.10.2018 HeiĂerer: Thomas Manns Wagner-Vortrag
11.09.2018 Osten: Wage es, glĂŒcklich zu sein
28.08.2018 Brodowy: Mein Goethe
12.06.2018 SchmÀlzle: Winckelmanns Laokoon-Deutung
08.05.2018 Borchmeyer: Was ist Deutsch?
10.04.2018 Kreter: StÀdtische Erinnerungskultur
10.04.2018 Mitgliederversammlung 2018
06.03.2018 Preisendörfer: Reisen zur Goethezeit
13.02.2018 Osterloh: Rom und Weimar
09.01.2018 Meier: Drei Generationen in ltalien
05.12.2017 Meuer: Marienbader Elegie II
14.11.2017 Soboth: Goethes Pietismus
08.11.2017 Grawe: Jane Austen und ihre Romane
17.10.2017 Filips: Reformationskantate
12.09.2017 Hofmann: Goethes Luther
07.09.2017 Paulin: Die BrĂŒder Schlegel
28.08.2017 Meister: Mein Goethe
06.06.2017 Raffael und Goethe
09.05.2017 Werthers Weltschmerz
04.04.2017 Von Hannover nach Moskau
14.03.2017 Schopenhauer und die Farbenlehre Goethes
14.02.2017 Goethe fĂŒr fast alle Lebenslagen
06.12.2016 Peter Meuer: Die Marienbader Elegie
08.11.2016 Goethes Briefe an Charlotte von Stein
18.10.2016 Christiana von Goethe zum 200. Todestag
13.09.2016 Die Briefe der Christiana von Goethe
28.08.2016 Goethes Geburtstag
07.06.2016 Sommerfest
10.05.2016 Kesting, Leben m. Literatur
12.04.2016 Massenet, Faust
08.03.2016 Manns "Tonio Kröger"
09.02.2016 Mose gegen Hitler
12.01.2016 Schillers "Verbrecher"
08.12.2015 "...fĂŒr Julie"
10.11.2015 G. in SĂŒditalien
06.10.2015 Betrogene BetrĂŒger
02.10.2015 FAUST
08.09.2015 Arno Schmidt
28.08.2015 Mein Goethe!
14.07.2015 Fontanes "Schach"
09.06.2015 Culemanns Sammlung
08.05.2015 90 Jahre GGH
14.04.2015 OMV f. Mitglieder
10.03.2015 A. Graffs Portraits
10.02.2015 Hannover literarisch?
27.01.2015 Die GG in Weimar
11.11.2014 Werther Lenz!
07.10.2014 Friederike Brion
09.09.2014 Jean Paul: Siebenk.
28.08.2014 "Mein Goethe!"
08.07.2014 Arabeske i. KĂŒnsten
10.06.2014 Th. Mann u. Schuld
13.05.2014 Briefschreiber "G."
08.04.2014 Goethe u. Mendels.
11.03.2014 Goethes "Harzreise"
11.02.2014 A. Freyherr Knigge
14.01.2014 Goethe und Wagner
03.12.2013 Pulcinella
12.11.2013 J.H. Ramberg
15.10.2013 Felix Goethe-Krull
10.09.2013 Schillers Spiele
28.08.2013 Mein Goethe!
09.07.2013 Marianne v. Willem.
11.06.2013 Woyzecks SchÀdel
14.05.2013 Der sÀkulare Goethe
09.04.2013 Albert Oppermann
12.03.2013 Goethe - Bergbau
12.02.2013 Mephisto
08.01.2013 Weimarer Klassik
04.12.2012 Slg. Culemann
13.11.2012 Goethes Antike
04.11.2012 Louis Meyer
16.10.2012 "Faust" u.d. Geld
11.09.2012 Theodor Storm
28.08.2012 Mein Goethe!
10.07.2012 Amors Pfeile
12.06.2012 Goethe in Venedig
08.05.2012 "Die BĂŒrgschaft"
17.04.2012 Mitglieder-Vers.
13.03.2012 WalpurgisnÀchte
14.02.2012 Rossini bei Goethe
10.01.2012 August Kestner
06.12.2011 Goethes Notizbuch
08.11.2011 J.W.L. Gleim
30.10.2011 Die Zelter-Briefe
11.10.2011 Kleist traf Goethe
13.09.2011 Medizinisches
28.08.2011 Mein Goethe!
07.06.2011 Doktor Faustus
10.05.2011 Abenteuer Wissen
08.03.2011 Goethe-Mendelss.
08.02.2011 Goethes Eckermann
11.01.2011 Goethezeit-Theater
09.11.2010 Der Kunschtmeyer
05.10.2010 Venedig 1790
14.09.2010 Karl J. Hirsch
10.08.2010 Kriegskommissar G.
08.06.2010 Metam. d. Pflanzen
11.05.2010 Vertrauen bei Kleist
12.01.2010 Dornburger Ged.
Vortragsreihe Große Romane
27.02.2024 Abschied nach 14 Jahren Weltliteratur27.02.2024 Bachmann: Undine geht
30.01.2024 Faulkner: Der Baer
28.11.2023 Simenon: Der kleine Schneider
24.10.2023 Gide: Die Rueckkehr
26.09.2023 Hermelin: Der Leutnant Yorck
31.01.2023 Carver: Wovon wir reden
22.11.2022 Mann: Die Betrogene
01.11.2022 Bunin: Der Herr aus San Francisco
27.09.2022 dâAurevilly: Der karmesinrote Vorhang
28.06.2022 Andersch: Vater eines Mörders
17.05.2022 Tschechow: Dame mit dem HĂŒndchen
26.04.2022 Doyle: Sherlock Holmes
25.11.2021 Eichendorff: Taugenicht
28.10.2021 DĂŒrrenmatt: Die Panne
30.09.2021 Leskow: Der ToupetkĂŒnstler
27.10.2020 ENTFALL Mann: Die Betrogene
29.09.2020 Maupassant: Boule de suif
01.04.2020 *AUSFALL* Diderot: Weibliche Rache
25.02.2020 Goethe: Novelle
28.01.2020 Melville: Bartleby, der Schreiber
26.11.2019 France: Die AffÀre Crainquebille
29.10.2019 Droste-HĂŒlshoff: Die Judenbuche
24.09.2019 Harte: Das GlĂŒck von Roaring Camp
25.06.2019 Puschkin: Pique Dame
28.05.2019 Kleist: Die Marquise von O...
26.03.2019 Zweig: Die Schachnovelle
26.02.2019 Seghers: Der Ausflug der toten MĂ€dchen
29.01.2019 Poe: Die Morde in der Rue Morgue
20.11.2018 Dickens: Ein Weihnachtslied in
23.10.2018 Irving: Die Legende von Sleepy Hollow
25.09.2018 Thurber: Walter Mittys Geheimleben
26.06.2018 Mörike: Mozart auf der Reise nach Prag
29.05.2018 Maugham: Regen
24.04.2018 Hoffmann: Der Sandmann
13.03.2018 Mérimée: Carmen
20.02.2018 Schnitzler: FrÀulein Else
16.01.2018 Böll: Dr. Murkes gesammeltes Schweigen
28.11.2017 Tolstoi: Krieg und Frieden
24.10.2017 Kertész: Roman eines Schicksallosen
26.09.2017 Gontscharow: Oblomow
29.08.2017 Mann: Der Untertan
23.05.2017 Pamuk: Das schwarze Buch
25.04.2017 Wilde: Das Bildnis des Dorian Gray
28.03.2017 Stevenson: Der Master von Ballantrae
28.02.2017 Flaubert: Madame Bovary
31.01.2017 Franz Kafka: Der Prozess
22.11.2016 Miguel de Cervantes: Don Quijote
27.09.2016 Iwan Turgenjew: VÀter und Söhne
30.08.2016 GĂŒnter Grass: Der Butt
28.06.2016 Döblin: Berlin Alexanderpl.
24.05.2016 Twain: Huckleberry Finn
26.04.2016 Balzac: Verl. Illusionen
22.03.2016 MĂĄrquez: Patriarch
24.03.2015 Mann: Zauberberg
24.02.2015 Maupassant: Bel-Ami
13.01.2015 Stendhal: Rot u. Schw.
25.11.2014 Prévost: M. Lescaut
28.10.2014 Moritz: Anton Reiser
23.09.2014 Sterne: Tristram S.
24.06.2014 Fitzgerald: Gatsby
20.05.2014 Lampedusa: Leopard
29.04.2014 Brontë: Sturmhöhe
25.03.2014 Fontane: J. Treibel
25.02.2014 Melville: Moby Dick
28.01.2014 Dickens, Gr.Erwart.
26.11.2013 Werthers Leiden
29.10.2013 Stolz u. Vorurteil
24.09.2013 Robinson Crusoe
Vortragsreihe Grundschriften
25.06.2013 Reineke Fuchs28.05.2013 Ecce homo
23.04.2013 Marx, Manifest
19.03.2013 Kant, AufklÀrung
26.02.2013 Rousseau, Natur
29.01.2013 Voltaire, Toleranz
27.11.2012 Grimm, MĂ€rchen
30.10.2012 Andersen, MĂ€rchen
25.09.2012 1001 Nacht
26.06.2012 Hamlet
22.05.2012 Montaigne: Essays
24.04.2012 Utopia
20.03.2012 Gregorius
19.03.2012 Kant, AufklÀrung
28.02.2012 Der Decamerone
31.01.2012 Aeneis
22.11.2011 Die Orestie
25.10.2011 Die Odyssee
27.09.2011 Das Buch Genesis
21.06.2011 Garg. u. Pantagruel
17.05.2011 Artus' Tafelrunde
19.04.2011 Das Nibelungenlied
22.03.2011 Göttliche Komödie
15.02.2011 Germania
18.01.2011 Die Metamorphosen
23.11.2010 Sokrates, Apologie
26.10.2010 König Ădipus
28.09.2010 Gilgamesh-Epos
Exkursionen
10.05.2025 Goethe in Schlesien28.10.2024 Goethe in Schlesien
04.09.2024 Lueneburg: Kant und sein Koenigsberg
29.11.2023 Bonn: Immanuel Kant
23.08.2023 Landesmuseum Hannover: Nach Italien
15.10.2022 Goethe in Florenz
15.06.2022 Deutsches Romantik-Museum
01.01.2021 *AUSFALL* Schumanns Werk âFaustâ
07.10.2019 Goethe in Mailand
18.05.2019 Goethe. Verwandlung der Welt
01.10.2018 Goethe in der Emilia Romagna
09.10.2017 Thomas Mann und Goethe in MĂŒnchen
01.10.2016 Auf Goethes Spuren in Norditalien
10.06.2016 "...auf den Harz"
01.11.2014 Sizilien (1, Norden)
24.09.2014 "auf den Harz" (2)
19.10.2012 Goethe in Rom
02.09.2011 DĂŒsseldorf
08.10.2010 Venedig
07.05.2010 Auf Kleists Spuren
04.09.2009 Leipzig
12.10.2008 Champagne
30.05.2008 Mit Goethe in Berlin
14.09.2007 Frankfurt am Main
23.07.2007 Schweizer Reise II
15.10.2006 Rheingau
12.05.2006 Lotte u. Wetzlar
16.09.2005 Meiningen, Bauerb.
10.06.2005 Schiller in Marbach
19.05.2005 Goethes Schiller
03.09.2004 Goethes Jena
12.07.2004 Schweizer Reise I
30.04.2004 Wörlitz-Dessau
15.08.2002 Goethes Weimar
08.12.2001 Th. Mann in LĂŒbeck
07.07.2000 Goethe in Halle
Archiv
Hat Schopenhauer die Farbenlehre Goethes verstanden?
Dienstag, den 14. 03. 2017
Theatermuseum, PrinzenstraĂe 9
Prof. Dr. Theda Rehbock (Technische UniversitÀt Dresden)
Kosten: FĂŒr Mitglieder der Goethe-Gesellschaft ist der Eintritt frei, Nichtmitglieder: 7 Euro, erm. 5 Euro
Mit seiner Schrift "Ăber das Sehn und die Farben" erhob der 25-jĂ€hrige Schopenhauer den Anspruch, Goethes Farbenlehre nicht nur zu verteidigen, sondern sie zu vollenden und im Kern zu korrigieren. Das eigentliche UrphĂ€nomen lĂ€ge nicht in der PolaritĂ€t von Licht und Finsternis, sondern in der physiologischen FunktionalitĂ€t des Auges. Eben damit aber vollzieht er eine Verbannung der Farben aus der Ă€uĂeren Welt in das sehende Subjekt, die mehr auf der Linie der Newtonschen Physik als der Goetheschen Farbenlehre liegt. Der Vortrag rekonstruiert Goethes Farbenlehre als eine philosophisch fundierte Kritik eben dieser Subjektivierung und GeringschĂ€tzung der Farben in Kunsttheorie, Physik und Philosophie. Die GrĂŒnde fĂŒr Schopenhauers (Miss-)VerstĂ€ndnis sind in seiner philosophischen Auffassung der "Welt als GehirnphĂ€nomen" zu finden, die von einer Sinnesphysiologie seiner Zeit geprĂ€gt, aber bis heute, im Zeitalter der Neurophysiologie, attraktiv geblieben ist.